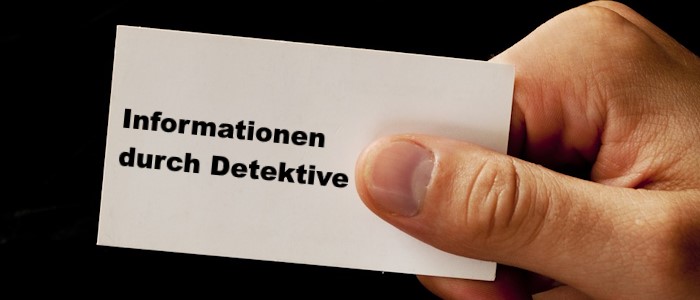Üble Nachrede beweisen – so gelingt es
Lesezeit: 6 Minuten
Rufschädigung in Form von übler Nachrede kann sich nicht nur erheblich auf die menschliche Psyche auswirken. Sie kann nachhaltig rufschädigend sein und ist somit mit Recht strafbar.
Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie üble Nachrede dokumentieren, um sich dagegen zu wehren.

Was ist üble Nachrede?
Üble Nachrede beschreibt das Behaupten und Verbreiten von sogenannten Tatsachen die die Ehre einer Person verletzen. Wichtig bei diesen Tatsachen ist, dass diese nicht wahr sind. Es geht auf gut Deutsch gesagt also darum, Lügen mit negativer Auswirkung über eine Person zu verbreiten.
Ähnlich der üblen Nachrede sind Verleumdung und Beleidigung. Die drei Begriffe unterscheiden sich jedoch rechtlich. Ein Beispiel:
Person A entdeckt sein zertrampeltes Gartenbeet und beschuldigt seinen Nachbar Person B, das gemacht zu haben. Wenn es sich bei dem Beet-Zerstörer nicht nachweislich um Person B handelt, ist es üble Nachrede. War Person B beispielsweise verreist, kann sie nicht Täter gewesen sein.
Von Verleumdung spricht man, wenn Person A bewusst ist, dass Person B nicht der Täter war. Person A könnte den eigenen Hund dabei beobachtet haben, wie dieser das Beet zertrampelte und es lediglich bewusst auf Person B schieben.
Wenn Person A dann Person B als einen „dummen Beetzertrampler“ bezeichnet, handelt es sich um Beleidigung.
Üble Nachrede unterscheidet sich ebenso zwischen dem Behaupten und dem Verbreiten der Nachrede.
- Das Behaupten beschreibt das wahre Hinstellen der Behauptung des Täters aus eigener Überzeugung.
- Um Verbreitung handelt es sich, wenn jemand die Tatsache als Gegenstand fremden Wissens weitergibt, ohne sich dieser Tatsache zu Eigen macht.
Nachweisen von übler Nachrede
Da handfeste Beweise für den behaupteten Straftatbestand vorhanden sein müssen, ist es in vielen Fällen schwierig üble Nachrede nachzuweisen.
Aufgrund der Ihnen gegenüberliegenden Aussage ist es nötig stichfeste Beweise vorzulegen, die diese Aussage widerlegen. Diese Beweise finden sich oft in Form von Foto- und Videodokumentation.
Zurück zu unserem Beispiel mit dem Beet, Hier könnte Person B, während sie verreist ist, Fotos von Erlebnissen, Sehenswürdigkeiten oder Ähnlichem geschossen haben. Diese reichen in der Regel aus, um den Sachverhalt zu klären.
Zeugenaussagen sind ebenso für Person B zielführend. Mit etwas Glück ist Person B nicht alleine verreist, sondern mit einem Lebensgefährten oder kann eine Hotelbestätigung vorlegen. Durch seine Aussage vor Gericht kann Person B die üble Nachrede bewiesen und die Aussage von Person A widerlegen.
Der Beweis der üblen Nachrede erfordert immer eine klare Unterscheidung zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen, da nur erstere gerichtlich überprüfbar sind. Der Beschuldigte kann sich entlasten, wenn er die Wahrheit der Behauptung beweist (Wahrheitsbeweis), in anderen Fällen kann eine Beweislastumkehr eintreten.
Relevante Beweismittel sind Zeugenaussagen, schriftliche Dokumente oder digitale Aufzeichnungen. Die Aufgabe besteht häufig darin, glaubwürdige Beweise zu sichern und nachzuweisen, dass die Behauptung verbreitet wurde.

Strafbarkeit der üblen Nachrede nach § 186 StGB
Die üble Nachrede ist ein Ehrdelikt gemäß § 186 Strafgesetzbuch (StGB) und stellt eine strafbare Handlung dar. Das gilt immer dann. wenn über eine Person ehrverletzende Behauptungen aufgestellt oder verbreitet werden, die nicht erweislich wahr sind.
Entscheidend für die Strafbarkeit ist, dass die Behauptung gegenüber Dritten geäußert wird - es genügt also nicht, dass nur eine Person betroffen ist. Die Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG findet hier ihre Grenze, wenn durch unwahre Tatsachenbehauptungen der Ruf einer Person geschädigt wird.
Die Strafe für üble Nachrede kann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr betragen. Wird die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften begangen, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.
Die Strafbarkeit unterscheidet sich von ähnlichen Delikten: Während bei der Beleidigung (§ 185 StGB) ehrverletzende Äußerungen auch ohne Dritte strafbar sind, setzt Verleumdung (§ 187 StGB) voraus, dass der Täter bewusst eine unwahre Behauptung aufstellt.
Ein relevanter Verteidigungsansatz kann die „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ (§ 193 StGB) sein, wenn beispielsweise Journalisten oder Whistleblower im öffentlichen Interesse handeln. In der Praxis ist die Beweisführung oft entscheidend, da die Beweislast beim Beschuldigten liegt – kann er die Wahrheit seiner Aussage nicht belegen, drohen rechtliche Konsequenzen.
Verjährungs- und Antragsfristen bei übler Nachrede
Bei der strafrechtlichen Verfolgung der üblen Nachrede spielen die Verjährungs- und die Antragsfristen eine entscheidende Rolle. Die Verjährungsfrist der üblen Nachrede nach § 186 StGB beträgt in der Regel drei Jahre. Sie beginnt mit der Begehung der Tat. Innerhalb dieser Frist kann die Tat strafrechtlich verfolgt werden, danach ist eine Ahndung nicht mehr möglich.
Da es sich bei der üblen Nachrede um ein sogenanntes Antragsdelikt handelt, muss das Opfer innerhalb einer bestimmten Frist aktiv werden, um die Strafverfolgung in Gang zu setzen. Nach § 77b StGB beträgt die Frist zur Stellung des Strafantrags drei Monate ab dem Zeitpunkt, in dem das Opfer von der Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt hat.
Wird innerhalb dieser Frist kein Strafantrag gestellt, bleibt häufig nur der zivilrechtliche Weg zur Durchsetzung von Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen.
In Ausnahmefällen kann die Staatsanwaltschaft tatsächlich auch ohne Strafantrag tätig werden. Das gilt dann, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Dies ist allerdings selten der Fall. Opfer von übler Nachrede sollten daher nicht zögern, sich rechtzeitig rechtlich beraten zu lassen, um ihre Rechte geltend zu machen.
Rechtliche Schritte bei Rufschädigung
Wer Opfer einer infamen Rufschädigung wird, hat verschiedene rechtliche Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Dabei ist zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen zu unterscheiden.
Strafrechtlich kann Anzeige wegen übler Nachrede oder Verleumdung erstattet werden, wenn nachweislich falsche Tatsachen verbreitet wurden.
Zivilrechtlich besteht die Möglichkeit, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend zu machen, insbesondere wenn ein nachweisbarer finanzieller oder persönlicher Schaden entstanden ist.
Gerade im Internet verbreiten sich rufschädigende Äußerungen schnell und sind für den Betroffenen nur schwer wieder zu entfernen. In solchen Fällen hilft eine anwaltliche Abmahnung oder eine einstweilige Verfügung, falsche Informationen löschen zu lassen.
Aber: Nehmen Sie stets die Unterscheidung zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung vor. Während falsche Tatsachenbehauptungen rechtlich angreifbar sind, fällt eine subjektive Meinung oft unter die Meinungsfreiheit.
Wer sich mit Rufschädigung konfrontiert sieht, sollte frühzeitig Beweise sichern und rechtlichen Beistand einholen, um effektiv gegen die Verbreitung falscher Informationen vorzugehen, um mit seinem Rechtsbeistand Unterlassungsansprüche geltend zu machen und falschen Informationen entgegen zu wirken.
Präventive Maßnahmen gegen Rufschädigung
Um sich wirksam vor Reputationsschäden zu schützen, ist es sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen sinnvoll, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.
Ein professionelles und konsistentes Auftreten in der Öffentlichkeit sowie ein respektvoller Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden tragen dazu bei, möglichen Reputationsschäden vorzubeugen.
Darüber hinaus kann soziales Engagement das Image in der Öffentlichkeit stärken und das Risiko ungerechtfertigter Anschuldigungen verringern.
Auch rechtliche Vorsorgemaßnahmen, wie die frühzeitige Durchsetzung von Unterlassungserklärungen oder die Dokumentation von potenziell rufschädigenden Äußerungen, können helfen, negative Entwicklungen frühzeitig einzudämmen.
Eine durchdachte Medienstrategie mit transparenter Kommunikation und aktiver Online-Präsenz trägt ebenfalls dazu bei, die eigene Reputation langfristig zu schützen und falsche Behauptungen schnell zu entkräften.
So beweisen Sie die üble Nachrede mit Hilfe externer Zeugen
Obwohl die üble Nachrede im Vergleich zu anderen Straftaten eher umständlich nachzuweisen ist, ist es wichtig, nötige Schritte zu ergreifen.
Charakteristisch für die üble Nachrede ist, dass man als Geschädigter den Schaden erst im Nachhinein - wenn es schon zu spät ist - mitbekommt. Von den getätigten Äußerungen erfährt man in der Regel als Letzter, weshalb Geschädigte oft bei der ersten üblen Nachrede nicht direkt agieren.
Daher sollten Sie schon bei der ersten nachweisbaren üblen Nachrede nicht zögern rechtliche Schritte einzuleiten. Sind die nötigen Nachweise nicht vorhanden, gibt es oft Möglichkeiten. diese über eine Detektei diskret zu beschaffen. Einem Privatdetektiv ist es möglich, diskrete Recherchen durchzuführen und somit gerichtsverwertbare Beweise festzustellen.
Schadensersatzansprüche bei übler Nachrede
Opfer von übler Nachrede haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Schadenersatz. Dabei wird zwischen materiellem und immateriellem Schaden unterschieden.
Materielle Schäden entstehen zum Beispiel, wenn rufschädigende Äußerungen zu finanziellen Einbußen führen - etwa durch den Verlust von Kunden, des Arbeitsplatzes oder von Geschäftspartnern.
Immaterielle Schäden betreffen das persönliche oder seelische Leid, das durch eine rufschädigende Äußerung entstehen kann.
Nach § 249 BGB kann der Geschädigte verlangen, so gestellt zu werden, als sei die Rufschädigung nicht erfolgt, während § 253 BGB eine Entschädigung für immaterielle Schäden, auch Schmerzensgeld genannt, ermöglicht.
Zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sind mehrere Schritte erforderlich. Zunächst muss der Geschädigte den Schaden nachweisen. Dazu gehören Unterlagen wie entgangene Aufträge, ärztliche Atteste bei psychischen Belastungen oder Nachweise über den Verbreitungsgrad der falschen Behauptung.
Auch Zeugenaussagen und die Beauftragung eines Detektivs zur Beweissicherung können hilfreich sein, wobei Detektivkosten erstattungsfähig sein können, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.
In vielen Fällen ist eine außergerichtliche Einigung durch eine Abmahnung oder eine strafbewehrte Unterlassungserklärung möglich. Reicht dies nicht aus, kann der Geschädigte eine zivilrechtliche Klage auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld erheben. Ein erfahrener Rechtsanwalt kann dabei helfen und die Erfolgsaussichten der Ansprüche einschätzen.
Lassen Sie sich jetzt beraten, wie wir Ihnen helfen
Wenn Sie Bedarf an einer Beratung haben, rufen Sie uns gleich an:
0800 – 11 12 13 14
Ebenfalls oft gelesen: